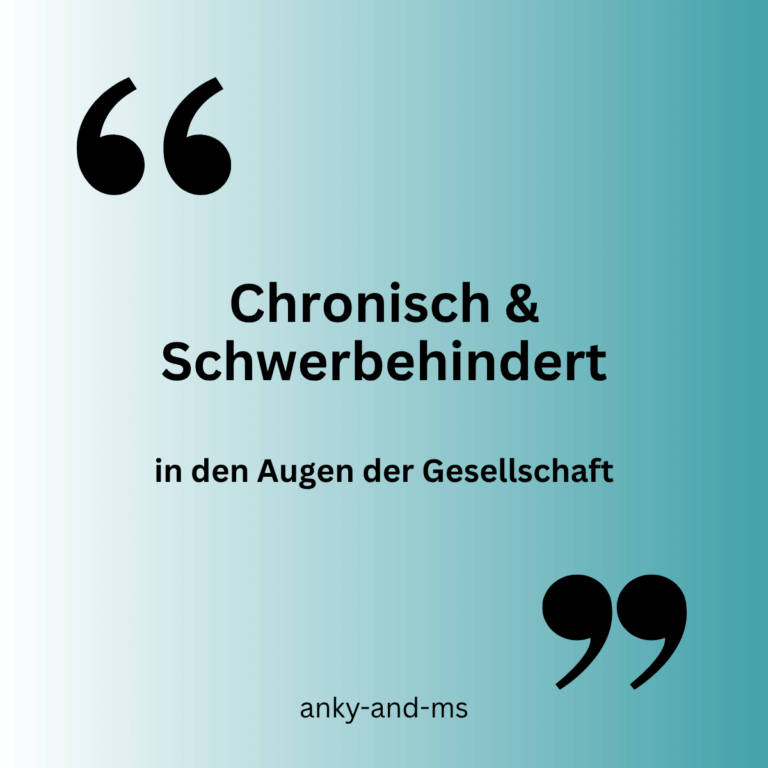
Typisches Bild von „Schwerbehindert“
Ein älterer Mensch im Rollstuhl, mit Pflegerin an der Seite. Er lebt in einem Heim oder braucht ständige Hilfe im Alltag. Schwerbehindert bedeutet für viele automatisch „pflegebedürftig, nicht mehr arbeitsfähig, eingeschränkt in jeder Lebenslage“.
Dieses Bild ist weit verbreitet – aber in der Realität nutzen nur ein kleiner Teil der schwerbehinderten Menschen dauerhaft einen Rollstuhl.
Die allermeisten haben unsichtbare Einschränkungen (z. B. Herz-Kreislauf-, Stoffwechsel-, psychische oder neurologische Erkrankungen) und viele sind noch im Arbeitsleben aktiv.
Typisches Bild von „chronisch krank“
Eine ältere, gebrechliche Person, die im Bett liegt, kaum noch das Haus verlässt, dauernd im Krankenhaus ist und ein „Ruhestand-Leben“ führt. Chronisch krank heißt in vielen Köpfen: alt, schwach, dauerhaft ans Haus gefesselt.
Auch das ist ein Klischee.
Tatsächlich sind viele chronisch Erkrankte jung, gehen zur Schule, studieren oder arbeiten – müssen aber mit dauerhaften Einschränkungen (z. B. Schmerzen, Fatigue, Diabetes, Rheuma, Autoimmunerkrankungen, psychische Belastungen) leben.
Die Erkrankung ist unsichtbar, aber prägt trotzdem den Alltag.
Die Zahl der schwerbehinderten Menschen ist hoch: Laut der aktuellsten Statistik des Statistischen Bundesamtes (Erhebung zum Stichtag 31. 12. 2023) lebten Ende 2023 in Deutschland rund 7,9 Millionen Menschen mit einem Grad der Behinderung (GdB) von mindestens 50 – das entspricht 9,3 % der Bevölkerung.
Schwerbehinderung ist selten angeboren oder auf Unfälle zurückzuführen. 91 % der schweren Behinderungen entstehen durch Krankheiten.
Körperliche Beeinträchtigungen betreffen bei 58 % vor allem innere Organe, Wirbelsäule, Gliedmaßen oder Sinnesorgane während 15 % seelische oder geistige Ursachen haben
Viele Behinderungen sind unsichtbar:
Das Beratungsunternehmen Stimulus fasst Zahlen des Statistischen Bundesamts so zusammen, dass 87 % der Menschen mit Behinderung keinen Rollstuhl nutzen.
Auch ein Schweizer Artikel zu „unsichtbaren Behinderungen“ weist darauf hin, dass nur etwa 20 % der Behinderungen sichtbar sind; bei rund 80 % sind Beeinträchtigungen oder Symptome auf den ersten Blick nicht erkennbar.
Beispiele sind chronische Schmerzen, Autoimmun‑ und Stoffwechselkrankheiten, Seh‑ oder Hörbeeinträchtigungen, Autismus‑Spektrum‑Störungen, psychische Erkrankungen oder neurologische Störungen.
Unsichtbare Symptome führen häufig zu Missverständnissen.
Eine Studie der Universität Marburg befragte 839 Betroffene mit Lupus Erythematodes (eine Autoimmunerkrankung) zu ihren Erfahrungen mit nicht sichtbaren Symptomen.
- 60 % gaben an, dass Müdigkeit zu Konflikten mit anderen führte,
- 58 % erlebten Konflikte wegen Erschöpfung
- 49 % wegen Schmerzen
- Über die Hälfte (52 %) berichtete, ihnen werde Faulheit unterstellt,
- fast die Hälfte (46 %) wurde beschuldigt, ihre Beschwerden „zu simulieren“ Diese Ergebnisse spiegeln den gesellschaftlichen Druck wider, sich für eine nicht sichtbare Erkrankung rechtfertigen zu müssen.
Diese Daten zeigen, dass Schwerbehinderung und chronische Erkrankungen keineswegs auf „alte Pflegefälle“ reduziert werden können.
Viele Beeinträchtigungen sind unsichtbar, betreffen innere Organe oder psychische Funktionen und sind in jeder Altersgruppe vertreten.
Junge Menschen mit chronischen oder schweren Krankheiten müssen sich daher häufig gegen stereotypische Erwartungen („zu jung“, „sieht nicht krank aus“) behaupten – obwohl sie zahlenmäßig keineswegs Einzelfälle sind.
Vielleicht schaffen wir es, diese Stereotypen zu brechen, und endlich neue Bilder in den Köpfen der Gesellschaft zu kreiieren.